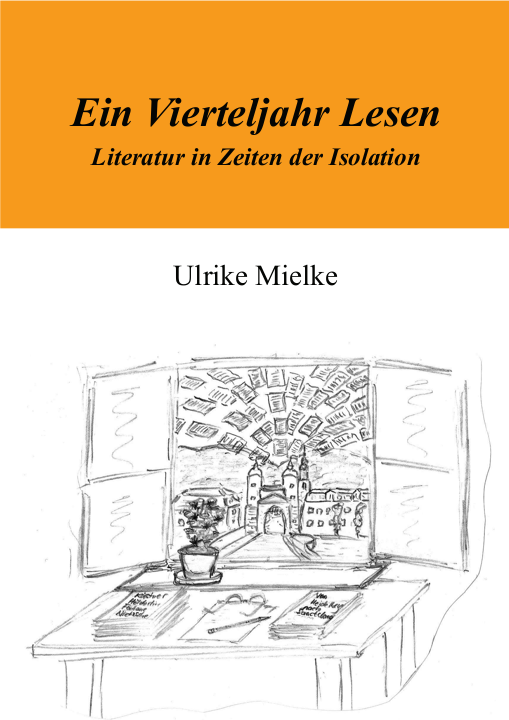Aber nimm an, du seiest in eine schwierige Lebenslage geraten und das Schicksal habe dir, sei es im häuslichen oder im öffentlichen Leben, wider alles Vermuten eine Schlinge umgeworfen, die du weder lösen noch zerreißen kannst, so denken die Gefesselten: Anfangs wird es ihnen schwer, sich mit ihrer Last und den hemmenden Fußketten zurecht zu finden; haben sie aber einmal den Vorsatz gefasst, statt darüber in Wut zu geraten, sich in ihr Schicksal zu fügen, so lehrt sie die Not, das Unvermeidliche tapfer, die Gewohnheit, es leichter zu tragen. In keiner Lebenslage wird es dir an Aufmunterungen, Erholungen und Aufheiterungen fehlen, wenn du es über dich gewinnst, das Schlimme lieber erträglich zu halten, als es dir verhasst zu machen. […]
Niemand würde es aushalten, wenn das Unglück bei weiterer Fortdauer immer dieselbe Kraft hätte wie beim ersten Schlag. Wir alle sind an das Schicksal gekettet, die einen mit goldener und gefügiger Kette, die anderen mit eng anschließender und rostiger; doch was kommt darauf an? Wir alle, ohne Unterschied, leben in einer Art Gefangenschaft, und angebunden sind auch die, die uns angebunden haben, […]. Den einen fesseln Ehrenstellen, den anderen Reichtum; einige leiden unter ihrer vornehmen Geburt, andere unter dem Gegenteil; manche müssen sich fremde Herrschsucht gefallen lassen, manche hinwiederum sind Opfer der eigenen.[…]
Darum gilt es, sich an seine Lage zu gewöhnen, so wenig als möglich zu klagen und keine Erleichterung, die es etwa bietet, unbenutzt zu lassen. […]
Hüten wir uns vor dem Neid gegen Höherstehende. […]
Wir dürfen nicht unnütze Ziele verfolgen und dürfen unsere Bemühungen nicht nutzlos verschwenden; das heißt, wir dürfen unsere Wünsche nicht auf Dinge richten, die für uns unerreichbar sind, und dürfen uns andererseits nicht in die Lage bringen, nach Durchsetzung unserer leidenschaftlichen Wünsche, die Nichtigkeit derselben zu spät unter tiefer Scham einzusehen. […] Aufhören muss man mit dem ewigen Hin- und Herrennen, das so viele Menschen in Atem hält.
Denn wer sich auf Vielerlei einlässt, der gibt dem Schicksal häufig Macht über sich, dem gegenüber das sicherste ist, sich nur selten mit ihm auf Proben einzulassen, wenn man auch immer an es denken und sich nichts von seiner Zuverlässigkeit versprechen soll. (S. 35f.)
De trancillitate animi, dt. Über die Seelenruhe, ist ein Traktat des ca. sechzigjährigen Seneca, den er um das Jahr 60 n. Chr. schreibt. Er antwortet in ihm seinem Freund Serenus, der einige Jahre jünger als er selbst ist. Serenus fühlt sich zwischen den stoischen Vorschriften und den Reizen der Welt hin- und hergerissen. Er möchte endlich zufrieden durchs Leben gehen, erreicht aber trotz aller Mühe einfach nicht die Unerschütterlichkeit, die in der stoischen Philosophie angestrebt werden soll. Der Traktat beginnt mit einem Brief von Serenus an Seneca, in dem er klare Fragen stellt und in dem er seinen Seelenzustand folgendermaßen umreißt:
Weder unbedingt frei fühlte ich mich von den Fehlern, die ich fürchtete und hasste, noch auch andererseits völlig in ihrer Gewalt. Ich befinde mich also, wenn auch nicht gerade in der schlimmsten, so doch in einer höchst kläglichen und verdrießlichen Lage: ich bin weder krank noch gesund. (S. 7)
Serenus, das Land vor Augen (S. 13), leidet Not. Er ist unzufrieden und zweifelt daran, dass er die richtige Lebensweise gefunden hat, fühlt sich überfordert mit allem, was von ihm erwartet wird, es ist ihm alles zu viel, der Luxus der Gesellschaft, die Sucht nach Ehrenstellungen, die Verpflichtungen im gesellschaftlichen Leben. Serenus steht vor der roten Ampel und fühlt sich ohnmächtig, das eigene Leben gut zu regeln. Eine Klage auf hohem Niveau, könnte man sagen. Ja, durchaus, aber das würde Serenus nicht weiterhelfen. Er sucht keine Abwechslung, er sucht einen Ausweg. Heute würde er zum Psychologen gehen. In der Antike, insbesondere in der römischen, versuchte man, die stoischen Lehren zu verstehen und daraus einen Wegweiser für sich zu entwickeln. Der Traktat hat eine Länge von gut fünfzig Seiten und gehört zu den großen Schriften Senecas.
Seneca antwortet ausführlich, und er packt die gesamte stoische Weisheit in seine Antworten. Wir brauchen kein großes Vorstellungsvermögen, um die Gedanken, die Seneca vor gut 2000 Jahren formuliert hat, auch heute anzuwenden. Er hat eine klare Sprache, die selbst schlechte Übersetzungen nicht kaputtkriegen.
Auch wir sind gefangen, derzeit mehr als sonst, leben isoliert in unseren Wohnungen und fühlen uns angesichts all der Gefahren, die die Pandemie mit sich bringt, ohnmächtig. Das Warten darauf, dass es besser wird, dauert schon lang. Mehr, als sich an die gegebenen Regeln halten, kann man kaum tun. Die Fußfesseln sitzen fest und keiner will dauerhaft mit ihnen leben. Es zeigt sich aber, dass damals wie heute der Schlüssel, um so eine zähe Zeit zu meistern, offensichtlich im Kopf liegt. Das Schicksal hat zugeschlagen, hat eine Schlinge umgeworfen, die du weder lösen noch zerreißen kannst. Schön ausgedrückt, lieber Seneca, denke ich, aber wie soll ich klarkommen? Wie soll ich das Unvermeidliche tapfer, die Gewohnheit leicht tragen? Wütend werden ist kein Ausweg. Aber wo finde ich Aufmunterungen, Erholungen und Aufheiterungen?
Seneca gibt zu, dass keiner Ketten auf Dauer aushalten kann. Aber er verweist darauf, dass Ketten, unabhängig vom Schicksalsschlag, eigentlich immer eine Rolle spielen. Er findet schöne Namen für sie: goldene, gefügige oder rostige Ketten. Hier muss ich schmunzeln. Was ist das Problem von goldenen Ketten, die sind doch sehr angenehm, oder? Nein, würde da der Stoiker sagen, denn auch sie machen abhängig. Aus einem goldenen Käfig auszusteigen, ist nicht minder schwer als sich aus einem rostigen zu befreien. Und am schlimmsten sind für Seneca die eigenen Ketten, die man sich selbst auferlegt. Er spricht vom Opfer der eigenen Herrschsucht. Wer sieht sich schon gern selbst als herrschsüchtig an? Und doch, hier spricht er Fragen an sich selbst an, die für die Stoiker ganz wichtig sind: Ist im eigenen Leben eine Eigenschaft, z. B. die Herrschsucht zu stark ausgeprägt? Wie komme ich zum erfüllten Leben? Mit Sicherheit nicht, indem ich mir das Leben ständig schwer mache. Mehr Chancen habe ich, wenn ich die Schwere des Lebens akzeptiere und freudig auch nach den Erleichterungen greife: Wirkliche Geistesgröße hat auch im Privatleben Raum genug sich zu entfalten. (S. 20) Diese Einstellung führt weg von der großen Bühne Welt. Der Stoiker kannte sein Tagesprogramm: Immer neu Ausrichtung finden, immer neu Fragen stellen, die neuralgisch die Punkte berühren, die ein Leben in die Schräglage bringen: Bin ich neidisch? Verfolge ich Ziele, die schlicht unerreichbar sind? Verzettele ich mich? Wo, wann, warum? Und all diese Überlegungen führen zur zentralen Frage: Was hat Macht über mich?
Seneca beruft sich in all seinen Schriften auf Grundpfeiler der stoischen Lehre. Der erste ist sicher: Lebe bewusst, lass Dir Dein Leben nicht aus der Hand nehmen. Seneca ist überzeugt davon, dass das Schicksal nicht der Grund ist, der dem Menschen ein Gut oder Übel zuteilt. Er glaubt, das Schicksal liefere lediglich den Stoff, der sich im Menschen zu einem Gut oder Übel entfalte. Daher plädiert er vehement dafür, dass das Einzige im menschlichen Leben, was den Menschen in allem Wandel und Wechsel der Dinge oben hält, der Mut zu sich selbst sei.
Mut zu sich selbst, das ist der Tenor der Antworten an Serenus. Dieser Mut zu sich selbst ist für Seneca der Garant dafür, dass der Mensch sorgenfreier und gelassener leben kann. Er wendet den Blick nicht nach außen, sondern sucht immer wieder die Einsicht für die richtige Lebensrichtung im eigenen Inneren.
Aussortieren ist auch wichtig. Seneca spricht ganz klar die Verzettelung an, die den Menschen immer mehr in Abhängigkeiten bringt und ihn ohnmächtig werden lässt. Hier fordert Seneca dazu auf, dass sich der Mensch nicht mit dem belaste, was für ihn im Hier und Jetzt nicht gilt. Dazu gehört alles, was an Belastendem aus dem vergangenen Leben gezogen wird. Dazu gehört auch die ganze Sorge um das zukünftige Leben. Alles dies hindere den Menschen zu leben.
Und letztlich entscheidend ist die Gesamtsicht. Seneca lehrt die Bedeutung des Gesamtentwurfs für das Leben. Er will den Menschen vor Sinnleere schützen. Bei ihm kommt es allein auf die rechte geistige Haltung an, damit Leben gelingt. Anker dafür ist die stoische Ruhe.
Der Serenus von heute würde vielleicht resigniert Seneca gegenüber argumentieren, dass er genug Mut zu sich habe und eigentlich wisse, wie man schwere Zeiten überbrücke, dass ihm aber doch auch die mangelnden Zukunftsperspektiven Schwierigkeiten mache und dass er in seinem täglichen Mühen um Sinnerfüllung zuweilen am Rand stünde. Und abgesehen davon, würde Serenus vielleicht noch anfügen, sein Geld ginge ihm irgendwann auch aus. Seneca würde verständig nicken und dann aber klar und schnörkellos darauf hinweisen, dass ihn die Umstände niemals aus der Bahn werfen sollten, wie widrig sie auch seien. Das Mühen um die innere Ruhe sei weit wichtiger als die Schrecken dieser Welt. Und bei diesem Mühen gebe die Vernunft die Richtung an. Denken könne man nicht delegieren, das müsse er schon selbst leisten. Das Dasein von innen her zu bestimmen und dadurch frei zu sein, das möge die Ausrichtung sein, die Serenus suchen solle. Zum Hinweis auf den finanziellen Engpass, würde Seneca vielleicht darauf hinweisen, dass Sorge um Zukunft Gegenwart entreiße.
Puh! Ich gebe zu, dass ich hier massive Schwierigkeiten habe, Seneca zu folgen. Ohne Geldsorgen lassen sich solche Thesen gut verteidigen. In der gesamten Antike, nicht nur in der römischen, war Philosophie ein Privileg des gehobenen Standes und da auch nur der Männerwelt. Frauen, Sklaven, Kinder hatten keinen Zugang zu philosophischem Denken. Was würde heute Seneca einem Flüchtling auf Lesbos sagen oder dem Schüler, der gerade von Boko Haram entführt worden ist? Es wäre mehr als zynisch, hier die eine Gefangenschaft mit der zu vergleichen, in der Seneca Serenus weiß.
Seneca selbst, obwohl in Cordoba geboren, hat den Status eines Römers. Finanzielle Sorgen kennt er nicht. Aber er kennt alle anderen Tiefen des Lebens. Krankheiten, Verbannung, Verschwörung, Verfolgung, Todesurteil. Den Tod hat er, der Asthmatiker, zeitlebens vor Augen. Hineingeboren in die Ära des Augustus, Jugendlicher bei Herrschaftsantritt von Tiberius, Anwalt und Senatsmitglied unter Caligula, zwingt ihn Nero, sein einstiger Schüler, in den Tod. Seine Lehre erlebt einen Siegeszug durch alle Epochen abendländischer Geschichte und ist heute besonders gefragt. Die Voraussetzung, sich nicht ohnmächtig dem Schicksal zu beugen, ist der richtige Blick. Von ihm aus wird das Ziel festgelegt, der Weg überlegt, es werden Sachkundige mit einbezogen. Seneca warnt davor, zum Herdenvieh zu werden, und ermuntert dazu, die eigene Urteilsfähigkeit zu pflegen. Auf die Frage, was genau der richtige Blick ist, hätte Seneca vielleicht geantwortet: der des Stoikers. Trump würde antworten: Meiner. Was würde ich antworten? Mir gefällt nach wie vor noch eine Antwort, die Hans Georg Gadamer einst in einem unserer Seminare gegeben hat: „Der andere könnte auch recht haben“. Mit anderen Worten ausgedrückt heißt das: Um den richtigen Blick zu bekommen, ist weit mehr als die eigene Sicht notwendig. Viel gehört dazu, Demut ist nötig, Offenheit und auch Mut.
Seneca: Von der Seelenruhe, übersetzt von Otto Apelt, Köln (Anaconda-Verlag) 2010